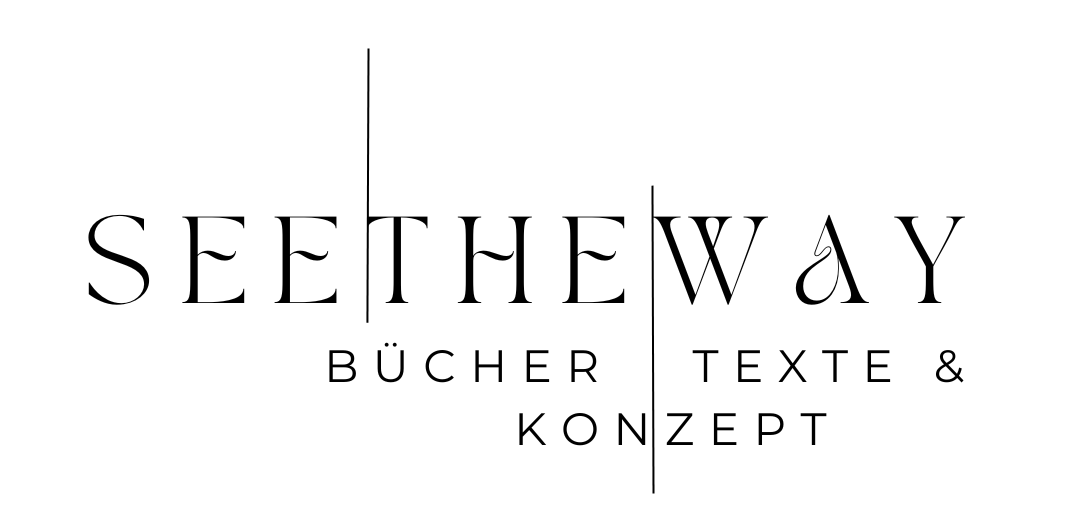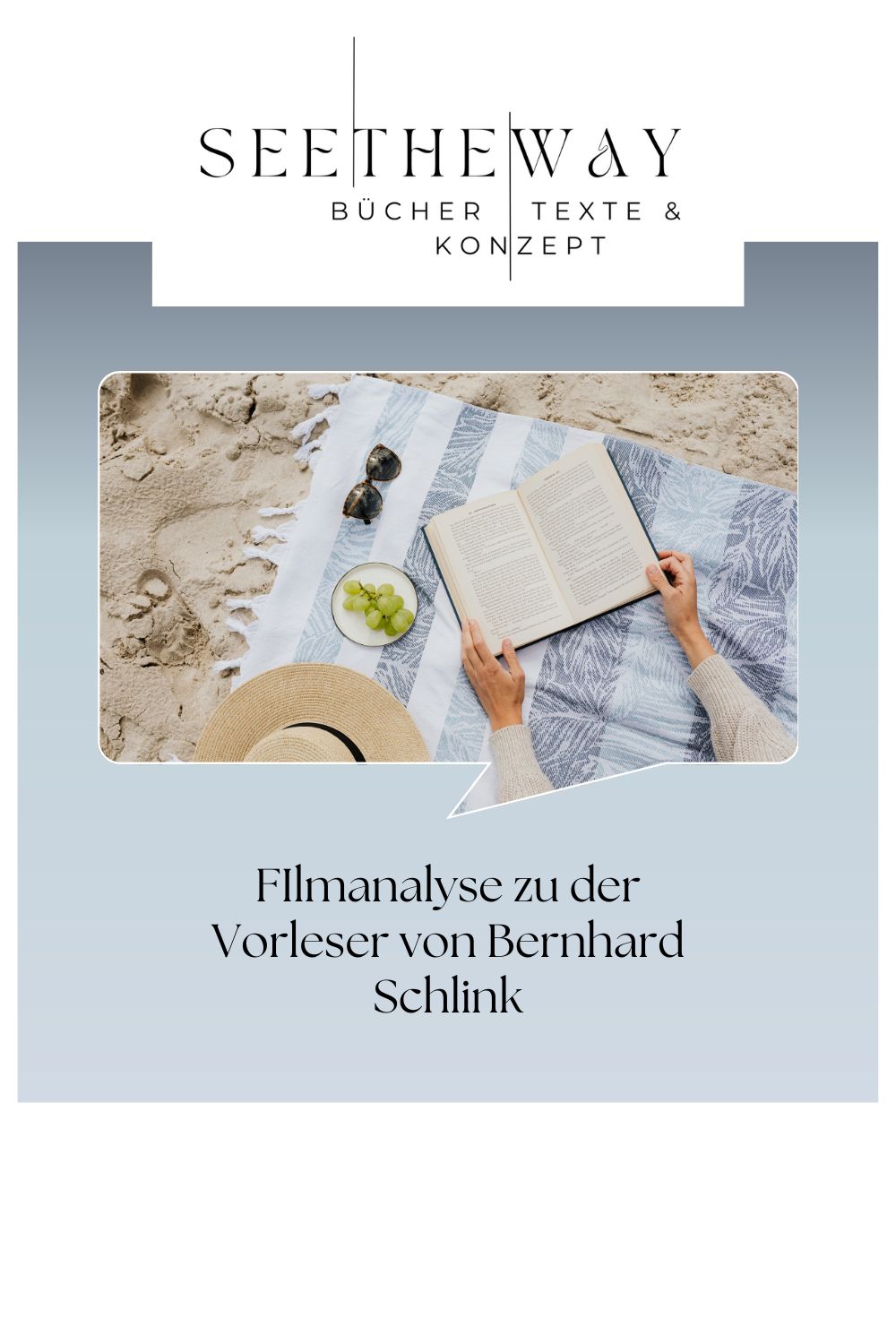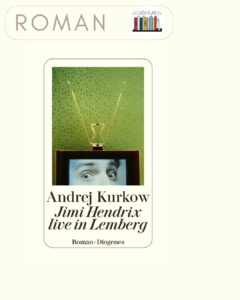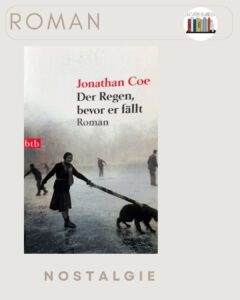Handlung
Im Jahr 1995 befindet sich der Jurist Michael Berg mit seiner Tochter Julia am Grab seiner ersten Liebe, Hanna Schmitz. Er teilt mit ihr erstmals die gesamte Geschichte über Hanna und sich.
Ein Rückblick führt in das Jahr 1958 nach Neustadt. Der damals fünfzehnjährige Michael Berg, von einer Krankheit geschwächt, erhält Hilfe auf dem Heimweg von einer Fremden – Hanna Schmitz, einer 36-jährigen Straßenbahnschaffnerin. Drei Monate später, nach Michaels Genesung vom Scharlach, sucht er die Fremde auf, um sich mit einem Blumenstrauß bei ihr zu bedanken. Schon an diesem ersten Tag entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Hanna, die ihn oft als „Jungchen“ bezeichnet, wahrt jedoch eine gewisse Distanz und so entsteht ein Ritual: Vor dem Intimwerden liest Michael aus Büchern vor, eine Taktik, mit der Hanna ihren Analphabetismus vor ihm verbirgt. Im Laufe der Zeit kühlt die Beziehung ab, Michael verbringt nun mehr Zeit mit seinen Schulkameraden, und auch eine Mitschülerin zeigt Interesse an ihm. Eines Tages verschwindet Hanna jedoch aus Gründen, die Michael verborgen bleiben.
Im Jahr 1966 begleitet Michael, während seines Jurastudiums seinen Professor zu einem Prozess gegen sechs ehemalige KZ-Aufseherinnen, darunter auch Hanna Schmitz. Die Äußerungen von Hanna im Gerichtssaal erscheinen rätselhaft. Sie versucht den brutalen Umgang mit den KZ-Häftlingen mit vermeintlich trivialen Gründen zu rechtfertigen. Während des Prozesses erheben die anderen Aufseherinnen gegen Ende Anschuldigungen gegen Hanna Schmitz und behaupten, sie trage die Hauptverantwortung für den Tod der 300 Häftlinge. Um dies zu belegen, soll eine Handschriftenprobe von Schmitz durchgeführt werden, die direkt mit der Akte der KZ-Aufseherinnen über den Kirchenbrand verglichen werden soll. Statt ihre Unfähigkeit zu lesen und zu schreiben zuzugeben, bestätigt Hanna jedoch die Vorwürfe.
Erst jetzt wird Michael bewusst, dass Hannas Geheimnis der Schlüssel zu vielen ihrer Handlungen ist. Dies schließt ihren Beitritt zur SS ein, die Tatsache, dass sie sich von KZ-Häftlingen wie einst von Michael aus Büchern vorlesen ließ, ihr plötzliches Verschwinden und sogar ihre selbstzerstörerische Übernahme der Hauptverantwortung im Prozess. Innerlich ringt Michael damit, das Gericht auf diesen entscheidenden Umstand hinzuweisen, entscheidet sich jedoch dagegen. Er rechtfertigt sein Zögern damit, dass Hanna die Offenlegung ihrer Schwäche durch ihn nicht gewollt hätte. Der Prozess endet mit Hannas Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe, während die anderen Aufseherinnen jeweils Freiheitsstrafen von vier Jahren und drei Monaten erhalten.
Im Jahr 1976 sucht Michael den Kontakt zu Hanna, die zu dieser Zeit inhaftiert ist und sendet ihr Um ihr Tonbandkassetten auf denen er vorliest. Durch diese Aufnahmen ermutigt, setzt Hanna den ehrgeizigen Versuch in Gang, sich selbst das Lesen und Schreiben beizubringen. In Reaktion darauf beginnt sie, Michael kurze Briefe zu verfassen.
1988 wendet sich die Leitung der Justizvollzugsanstalt an Michael Berg mit der Bitte, sich der kurz vor ihrer Entlassung stehenden Hanna Schmitz anzunehmen. Nach über 20 Jahren Haft hat sie weder Verwandte noch Bekannte. Michael, anfänglich zögerlich, willigt schließlich ein. Vor ihrer Freilassung besucht er die stark gealterte Hanna in der JVA. Michael gibt sich kühl und teilt ihr mit, dass er eine Wohnung und Arbeit für sie organisiert hat und sie in einer Woche abholen wird. Tragischerweise beendet Hanna jedoch vor ihrer Entlassung ihr Leben. In ihrem Testament beauftragt sie Michael, ihr erspartes Geld aus einer blechernen Teedose sowie 7.000 DM von ihrem Konto einer der beiden Überlebenden, Ilana Mather, die sie als „Tochter“ des Kirchenbrandes bezeichnet, zu übergeben.
Diese besucht Michael während eines Kongresses in Boston. Sie zeigt sich zurückhaltend und weist Michaels Versuche, Verständnis für Hanna Schmitz zu wecken, ab. Seine Offenbarung, dass Schmitz Analphabetin war, scheint bei ihr kaum Eindruck zu hinterlassen. Michael teilt ihr seine Liebesbeziehung zu Hanna mit. Ilana Mather lehnt das Geld ab, da sie es als eine Art Absolution betrachtet. Michael schlägt daraufhin vor, das Geld in Hannas Namen einer jüdischen Organisation zu spenden, die sich für Alphabetisierung einsetzt. Ilana Mather stimmt zu, unter der Bedingung, dass er sich darum kümmert. Für sich behält sie Hannas alte Teedose, die Michael ihr überbracht hat. Als Kind besaß sie eine ähnliche Dose, die sie ins Konzentrationslager mitnahm und die ihr nicht wegen ihres Inhalts, sondern aufgrund ihres Aussehens gestohlen wurde. Nach Michaels Abgang stellt sie die Dose neben das Erinnerungsfoto ihrer ermordeten Familie.
Veröffentlichung
„Der Vorleser“ ist ein deutsch-amerikanisches Filmdrama, das auf dem gleichnamigen Roman von Bernhard Schlink basiert. Der Film wurde von Stephen Daldry inszeniert und erstmals im Jahr 2008 veröffentlicht.
Welturaufführung: 10. Dezember 2008 in New York City.
Deutschland: 12. Februar 2009 in den Kinos veröffentlicht.
Spielzeit: 124 Minuten
Aspekte Vermarktung
Literarische Vorlage
Hochkarätige Besetzung: Die Präsenz bekannter und talentierter Schauspieler wie Kate Winslet und David Kross
Ernste und anspruchsvolle Themen: Obwohl der Film nicht für ein breites Mainstreampublikum geeignet ist, könnten seine ernsten und anspruchsvollen Themen dazu beigetragen haben, ein anspruchsvolles Publikum anzusprechen, das nach tiefgründigeren Geschichten sucht.
Historischer Kontext: Der Film spielt vor dem Hintergrund der deutschen Nachkriegszeit und berührt damit historische Themen.
Zielgruppe
Genre: Liebhaber von Dramen und anspruchsvollen Filmen, die komplexe Handlungen, emotionale Tiefe und ethische Dilemmata schätzen.
Alter: Der Film richtet sich eher an ein erwachsenes Publikum aufgrund seiner ernsten Themen und der Notwendigkeit einer reifen Perspektive, um die moralischen Dilemmata und die Entwicklung der Charaktere zu verstehen.
Konflikt: Menschen, die an komplexen menschlichen Konflikten und moralischen Dilemmata interessiert sind.
Genre und Themen
Drama/Gesellschaftsdrama: Der Film enthält gesellschaftliche Themen, insbesondere im Kontext der rechtlichen und moralischen Fragen, die im Verlauf der Handlung aufkommen.
Melodram: Beziehungskonflikt, Fokus auf Emotion: Ein zentrales Element des Films ist der emotionale Konflikt, insbesondere in den Beziehungen zwischen den Hauptcharakteren.
Historiendrama: Aspekte der Historie als Teil der Geschichte: Der Film hat historische Elemente, insbesondere im Zusammenhang mit den Ereignissen, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg stattfinden.
Literaturverfilmung: Adaption von Bernhard Schlinks Roman
Ethik und Schuld und Moralische Dilemmas: Die Frage nach Ethik und Schuld ist ein zentrales Thema im Film. Insbesondere im Zusammenhang mit Hannas Geheimnis und den moralischen Entscheidungen.
Beispiele:
Gesellschaftliche Konflikte und Moral: Die Darstellung des Gerichtsprozesses gegen Hanna Schmitz, bei dem sie sich für ihre Handlungen während ihrer Zeit als KZ-Aufseherin verantworten muss. Hier werden Fragen der Moral, Schuld und individuellen Verantwortung aufgeworfen.
Liebesdrama: Die intensive Beziehung zwischen Michael Berg und Hanna Schmitz, insbesondere während ihrer gemeinsamen Zeit, in der Michael ihr Bücher vorliest. Die emotionale Bindung zwischen den beiden prägt den Verlauf des Films.
Historiendrama: Die Darstellung der Nachkriegszeit in Deutschland und die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Gesellschaft. Der Film zeigt die Herausforderungen und den „Wiederaufbau“ nach einem traumatischen historischen Ereignis.
Bildungsdrama: Michaels persönliche Entwicklung vom Jugendlichen zum Erwachsenen und die Auswirkungen der Beziehung zu Hanna auf seine Werte und Weltanschauung. Der Protagonist durchläuft eine Reifung und Selbstfindung.
Ethik und Schuld: Die ethischen Dilemmata, mit denen Michael konfrontiert wird, als er Hannas Geheimnis erfährt. Die Frage, ob er sie vor Gericht entlarven soll, bringt komplexe moralische Überlegungen mit sich.
Gesellschaftliches Stigma: Die Art und Weise, wie Hanna nach ihrer Haftentlassung mit Vorurteilen und Stigmatisierung konfrontiert wird. Die Gesellschaft reagiert mit Unverständnis und Ablehnung auf ihre Vergangenheit.
„Der Vorleser“ lässt sich eher als eine Mischung charakterisieren. Der Film verbindet Elemente verschiedener Genres und Ansätze. Die Mischung von Drama, Liebesgeschichte, Historiendrama und ethischen Dilemmata macht ihn nicht unbedingt zu einem Mainstream-Film im traditionellen Sinne. Er könnte als „Mainstream“ betrachtet werden, wenn man bedenkt, dass er in gewissem Maße von einem breiteren Publikum gesehen wurde, aber seine Mischung von Genres und tieferen Themen hebt ihn von konventionellen Mainstream-Produktionen ab.
Dramaturgischer Verlauf
Exposition: Einführung in die Hauptcharaktere.
Etablierung der Zeit- und Ortsrahmen, einschließlich der Nachkriegszeit in Deutschland.
Konflikte: Vorstellung der Beziehung zwischen Michael und Hanna.
Die Offenbarung von Hannas Geheimnis und die ethischen Dilemmata, die daraus resultieren.
Steigende Handlung: Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Michael und Hanna.
Der Gerichtsprozess gegen Hanna und die Enthüllung ihrer Vergangenheit.
Höhepunkt: Der Höhepunkt könnte im Gerichtsprozess oder in der Konfrontation zwischen Michael und Hannas Geheimnis liegen.
Fallende Handlung: Die Konsequenzen des Gerichtsprozesses und die Entwicklung der Charaktere danach.
Michaels persönliche Reaktion auf die Enthüllung von Hannas Geheimnis.
Resolution: Die Handlungsstränge werden abgeschlossen, und es erfolgt eine Art Auflösung.
Michael reflektiert über seine Vergangenheit und die Auswirkungen von Hannas Geheimnis.
„Der Vorleser“ hat aufgrund seiner nichtlinearen Erzählstruktur und der komplexen moralischen Themen möglicherweise nicht ganz eine traditionelle dramaturgische Kurve. Vielmehr entwickelt sich die Handlung durch Rückblenden und aktuelle Ereignisse.
Erzählweise:
Die Erzählweise kann als geschlossen betrachtet werden, da die verschiedenen Handlungsstränge und Zeitebenen letztendlich zusammengeführt werden und zu einem Verständnis der Charaktere und ihrer Entscheidungen führen. Die Entscheidung für die nichtlineare Erzählweise ermöglicht es dem Film, die psychologische Tiefe der Charaktere zu erforschen und moralische Fragen auf komplexe Weise zu behandeln.
Hauptfiguren und Entwicklung:
Michael Berg:
Entwicklung: Michael Berg wird zu Beginn des Films als Jugendlicher vorgestellt, der eine intensive Liebesbeziehung zu Hanna Schmitz hat.
Seine Entwicklung ist von moralischen Dilemmata geprägt, insbesondere nachdem er Hannas Geheimnis im Zusammenhang mit dem KZ-Prozess entdeckt.
Als erwachsener Mann reflektiert er über seine Vergangenheit und versucht, den Einfluss von Hanna auf sein Leben zu verstehen.
Beispiel: Die Szene, in der der erwachsene Michael die Wohnung von Hanna betritt und ihre Persönlichkeit sowie die Spuren der Vergangenheit erforscht, spiegelt seine emotionale Entwicklung und Reflexion über die Vergangenheit wider.
Hanna Schmitz:
Entwicklung: Hanna wird als komplexe Figur eingeführt, die eine leidenschaftliche Beziehung zu Michael hat.
Nach ihrer Verwicklung in den KZ-Prozess und der Enthüllung ihres Analphabetismus zeigt sich ihre Zerrissenheit und die Folgen ihrer Entscheidungen.
In der Haft entwickelt sie sich weiter, indem sie durch Michaels Aufnahmen das Lesen und Schreiben lernt.
Beispiel: Die Szene, in der Hanna sich das Lesen beibringt, während sie Michaels Aufnahmen hört, zeigt ihre Verletzlichkeit und ihren Wunsch nach persönlichem Wachstum, gleichzeitig aber auch die Tragödie ihrer Vergangenheit.
Finale Handlung, Ziel und Hindernisstruktur:
Die finale Handlung des Films konzentriert sich auf die späten 1990er Jahre, als der erwachsene Michael Berg auf Hanna Schmitz trifft, die inhaftiert ist.
Hanna hat ihre Strafe abgesessen und steht kurz vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis.
Michael, der inzwischen Jurist ist, entwickelt eine Art Versorgungsverhältnis zu Hanna und bereitet sich darauf vor, sie nach ihrer Freilassung zu unterstützen.
Die finale Wendung tritt auf, als Hanna sich das Leben nimmt, kurz bevor sie das Gefängnis verlässt.
Zielstruktur:
Das Ziel von Michael scheint darin zu bestehen, Hanna nach ihrer Freilassung zu helfen und für sie zu sorgen.
Hanna hat ein eigenes Ziel, sich selbst das Lesen und Schreiben beizubringen, was sie während ihrer Haft erreicht.
Hindernisstruktur:
Ein zentrales Hindernis ist das Geheimnis um Hannas Analphabetismus, das Michael erst während des KZ-Prozesses entdeckt.
Michaels innere Konflikte und Schuldgefühle aufgrund seiner Beziehung zu Hanna und seiner Entscheidung, ihr Geheimnis nicht zu offenbaren, stellen Hindernisse dar.
Hannas Inhaftierung und der Prozess, den sie durchläuft, sind ebenfalls bedeutende Hindernisse in der Handlung.
Plot-Points
Die Begegnung von Michael und Hanna:
Ein entscheidender Plot-Point ist die erste Begegnung zwischen dem jungen Michael und Hanna. Dies markiert den Beginn ihrer ungewöhnlichen Liebesbeziehung, die den Kern der Geschichte bildet.
Entdeckung von Hannas Geheimnis:
Ein wichtiger Plot-Point ist die Entdeckung von Hannas Analphabetismus während des KZ-Prozesses. Dies stellt eine entscheidende Wende dar und führt zu moralischen Konflikten für Michael, der sich entscheidet, Hannas Geheimnis nicht zu offenbaren.
Hannas Verurteilung und Inhaftierung:
Die Verurteilung von Hanna zu lebenslanger Haft ist ein bedeutender Plot-Point, der den Verlauf der Geschichte beeinflusst und zu einer Trennung der beiden Hauptfiguren führt.
Kontakt zwischen Michael und Hanna im Gefängnis:
Der Moment, in dem Michael nach Jahren wieder Kontakt zu Hanna aufnimmt, indem er ihr vorgelesene Tonbandkassetten schickt, markiert einen weiteren wichtigen Plot-Point. Dies leitet eine neue Phase in ihrer Beziehung ein.
Hannas Tod und Testament:
Der tragische Tod von Hanna kurz vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ist ein entscheidender Plot-Point. Ihr hinterlassenes Testament, in dem sie Michael bittet, Geld an Ilana Mather zu übergeben, bildet den Abschluss der Geschichte.
Nebenhandlung
Die Beziehung zu Julia:
In der Rahmenhandlung des Films im Jahr 1995 wird Michael Berg als erwachsener Mann mit seiner Tochter Julia eingeführt.
Julia ist die einzige Person, der Michael die ganze Geschichte über seine Beziehung zu Hanna offenbart.
Die Interaktionen zwischen Michael und Julia dienen dazu, Michaels inneren Konflikt und seine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu reflektieren.
Die Beziehung zu Julia dient als Rahmen, der die zentralen Themen des Films miteinbezieht und eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herstellt.
Gesellschaftliche Themen und Problematisierung:
Nachkriegsdeutschland:
Der Film spielt in der Nachkriegszeit Deutschlands und wirft einen Blick auf die physischen und emotionalen Narben, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat.
Es werden die Herausforderungen der deutschen Gesellschaft bei der Bewältigung der Vergangenheit und dem Umgang mit den Verbrechen der Nationalsozialisten thematisiert.
Liebe und Schuld:
Die Liebesbeziehung zwischen Michael Berg und Hanna Schmitz ist von moralischen Dilemmata durchzogen. Der Film erforscht die ethischen Konsequenzen dieser Beziehung, besonders wenn Hannas Verbrechen während des KZ-Prozesses offenbart werden.
Schuld und Vergebung:
Die Figur von Michael Berg wird mit Schuldgefühlen konfrontiert, insbesondere wegen seiner Entscheidung, Hannas Analphabetismus nicht zu enthüllen. Der Film erkundet die Komplexität der Schuld und die Suche nach Vergebung.
KZ-Prozess:
Der Film thematisiert den KZ-Prozess gegen Hanna Schmitz und präsentiert eine kritische Betrachtung der individuellen Verantwortung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Banalisierung von Grausamkeiten wird dabei besonders betont.
Verarbeitung der Vergangenheit:
Die Figuren im Film, insbesondere Michael, versuchen auf unterschiedliche Weisen, mit ihrer eigenen Vergangenheit umzugehen. Die Verarbeitung von Traumata und die Unmöglichkeit, die Vergangenheit zu ändern, sind zentrale Themen.