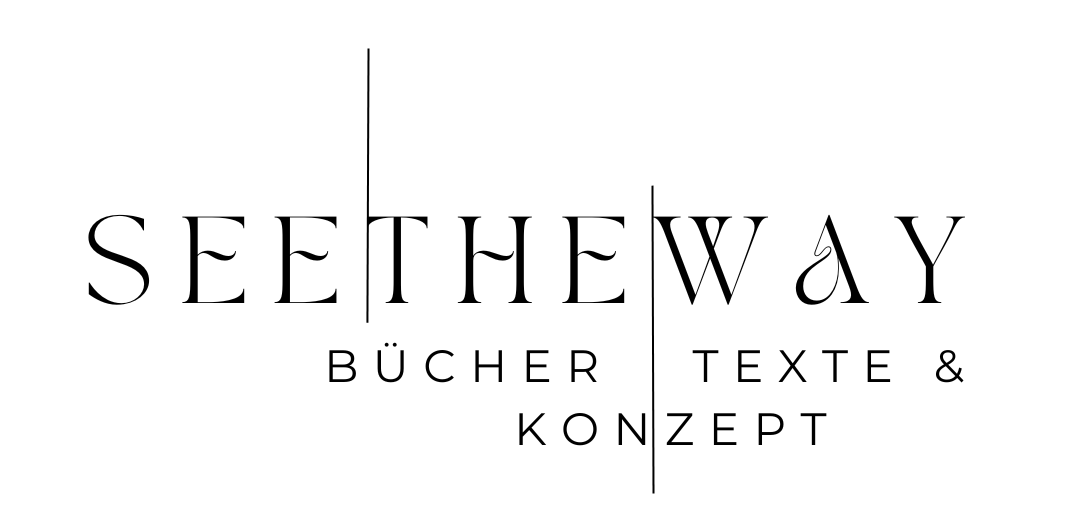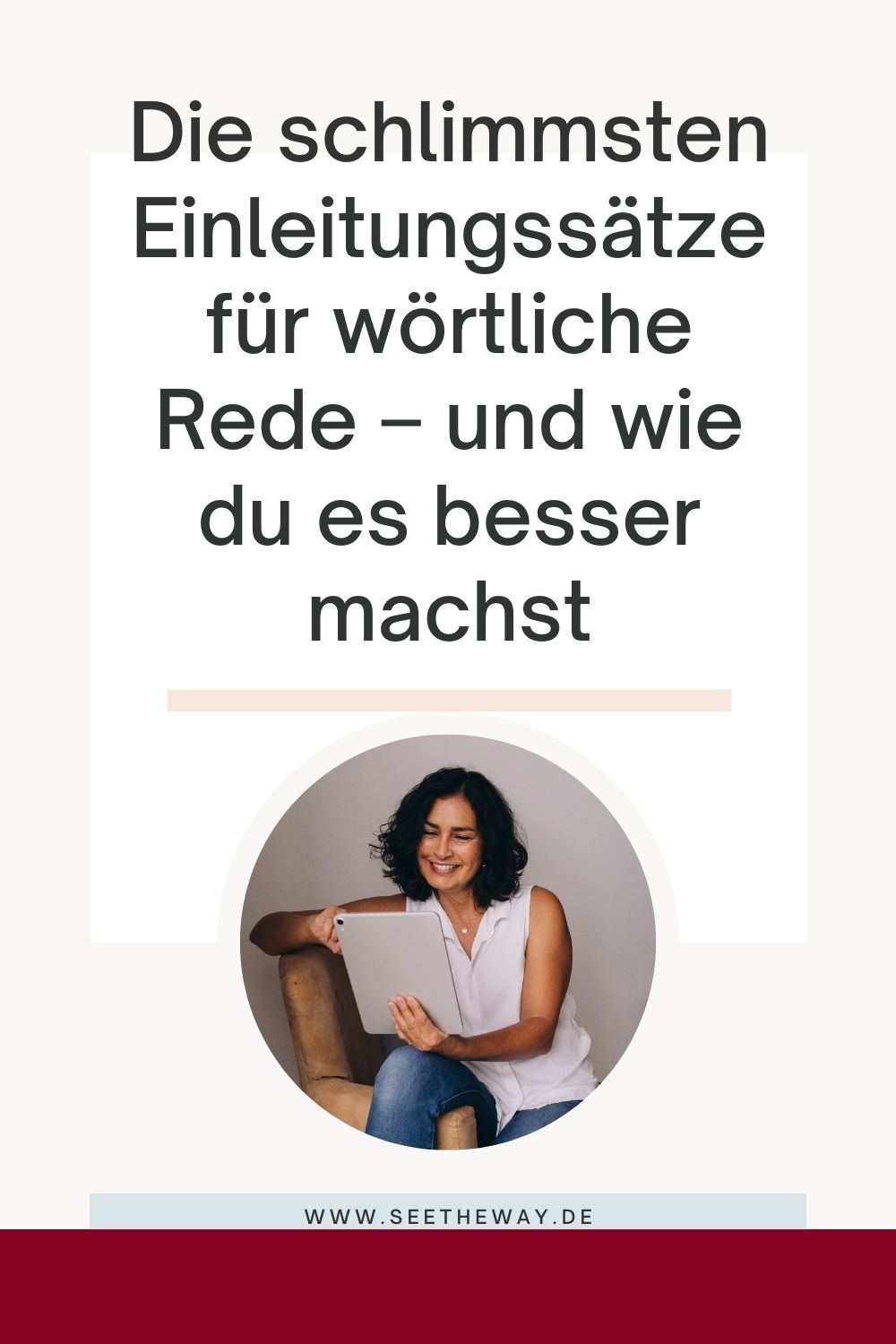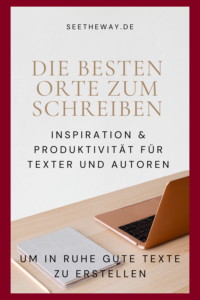Dialoge sind das Herzstück einer guten Geschichte. Sie bringen Figuren zum Leben, treiben die Handlung voran und sorgen für Dynamik. Doch es gibt eine Sache, die Dialoge gnadenlos ruinieren kann: schlechte Einleitungssätze.
Stephen King hat es in seinem Buch „On Writing“ klargestellt: Adverbien in Einleitungssätzen sind der Tod eines guten Dialogs. Doch es gibt noch mehr Fehler, die du vermeiden solltest. Hier sind zehn Arten von Einleitungssätzen, die du besser aus deinem Schreibstil verbannst – plus Tipps, wie du es richtig machst.
1. Das „adverbiale Verbrechen“
„Ich liebe dich“, sagte er sanft.
Das Problem? Das Adverb sanft ist überflüssig. Wenn der Dialog stark genug ist, zeigt er die Emotion von selbst. Besser wäre: „Ich liebe dich“, sagte er. Oder noch besser: Lass die Handlung für sich sprechen!
2. Das übertrieben dramatische Synonym
„Du bist gefeuert!“, explodierte er.
Nicht jede wörtliche Rede braucht ein alternatives Wort für sagen. Wenn dein Charakter „explodiert“, ist das meistens unnötig und klingt unfreiwillig komisch. Einfach „Du bist gefeuert!“, sagte er. reicht völlig aus.
3. Das „Zeige-und-erkläre-Dilemma“
„Hau ab!“, schrie sie laut.
Schreien ist bereits laut. Das Wort laut ist hier überflüssig. Setze lieber auf eine gute Beschreibung der Szene: „Hau ab!“ Sie sprang auf und riss die Tür auf.
4. Das übertechnisierte Einleitungswort
„Ich glaube nicht daran“, artikulierte er.
Artikulieren ist ein schönes Wort – für wissenschaftliche Abhandlungen. In Romanen wirkt es gestelzt. Halte es simpel: „Ich glaube nicht daran“, sagte er.
5. Der unnötige Infodump
„Wir müssen sofort nach Paris fliegen, weil mein Onkel, der vor 20 Jahren verschwand, sich plötzlich dort aufhält“, erklärte sie.
Infodumps in Dialogen wir5.ken unrealistisch. Würde jemand das wirklich so sagen? Zeige die Informationen stattdessen in kleinen Häppchen.
6. Das emotionslose „sagte er einfach“
„Ich bin am Boden zerstört“, sagte er traurig.
Das Wort traurig wird hier nicht gebraucht. Die Emotion sollte sich aus dem Gesagten und der Handlung ergeben. Eine bessere Version: Er senkte den Blick. „Ich bin am Boden zerstört.“
7. Der unpassende Vergleich
„Ich liebe dich“, flüsterte sie wie eine sanfte Sommerbrise.
Klingt poetisch, aber wer flüstert schon wie eine sanfte Sommerbrise? Vergleiche sind im Dialog meist fehl am Platz. Lass sie lieber weg.
8. Das falsche Verb für wörtliche Rede
„Nein“, grinste er.
Man kann nicht grinsen und gleichzeitig sprechen. Besser wäre: Er grinste. „Nein.“
9. Der künstliche Dialekt
„Isch wees nich, watte meens“, murmelte er.
Dialekte und Akzente in wörtlicher Rede sind schwierig. Zu viel davon macht den Text unlesbar. Nutze sie sparsam und arbeite stattdessen mit Wortwahl und Satzbau, um einen Dialekt anzudeuten.
10. Das übererklärte Gefühl
„Das ist unfair!“, sagte sie wütend.
Wenn die Wut schon im Dialog steckt, braucht es keine zusätzliche Erklärung. Verstärke die Emotion lieber durch eine Handlung: Sie ballte die Fäuste. „Das ist unfair!“
Weniger ist mehr
Gute Dialoge kommen ohne unnötige Schnörkel aus. Vermeide überflüssige Adverbien, seltsame Synonyme und unnatürliche Erklärungen. Setze stattdessen auf starke Wortwahl, Körpersprache und klare, prägnante Einleitungssätze. Dann wird dein Dialog lebendig – ganz ohne „er explodierte“.